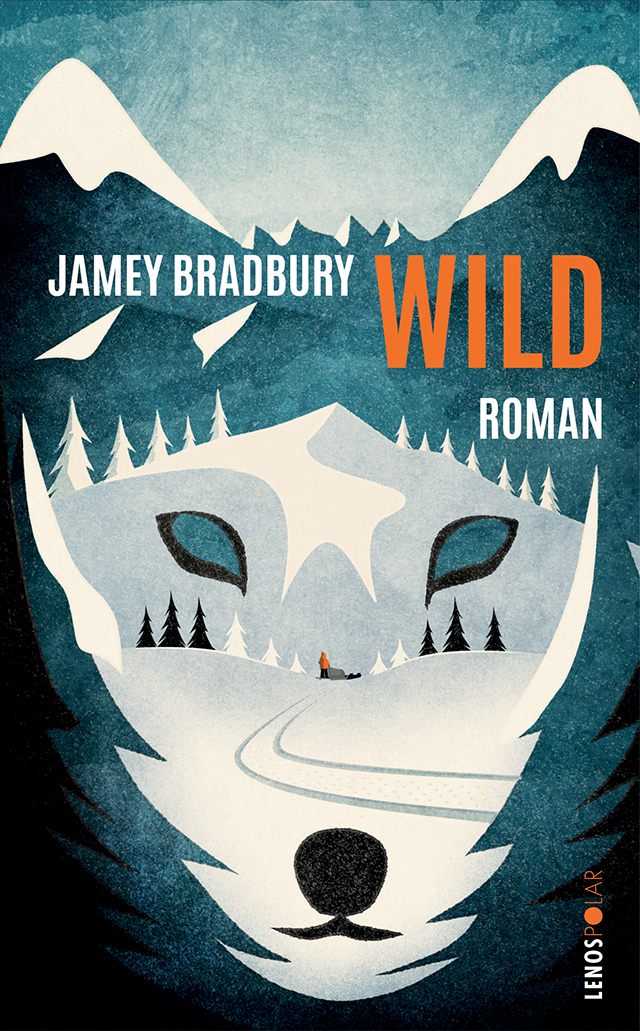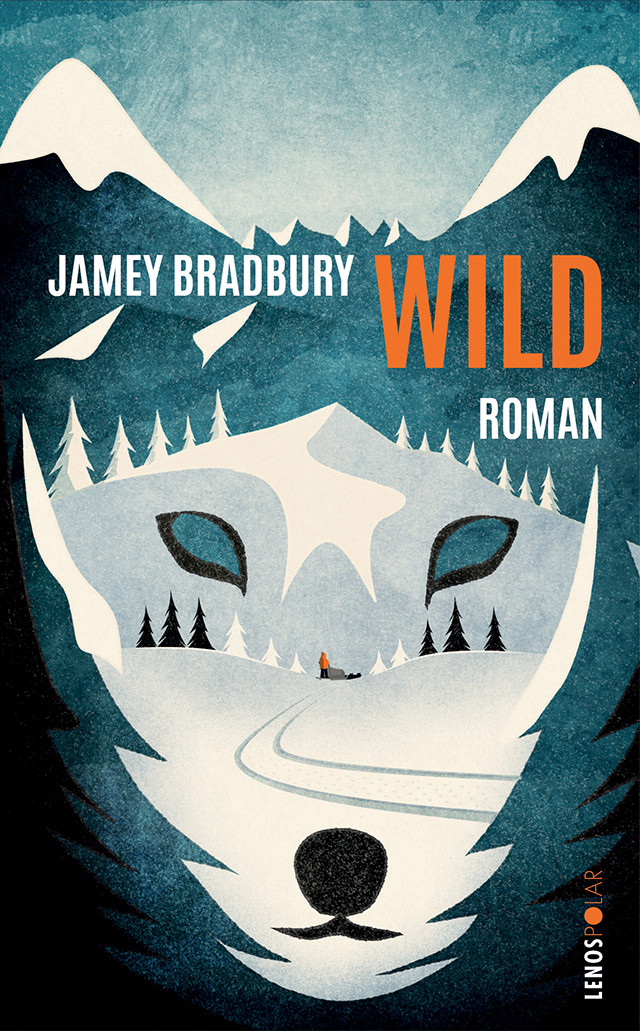Jamey Bradbury
Wild
Aus dem Amerikanischen von Lydia Dimitrow
E-Book
ISBN 978-3-03925-703-4
Seiten ca. 400
Erschienen 31. Oktober 2022
€ 18.99
Die siebzehnjährige Tracy lebt mit Vater und Bruder in der Wildnis Alaskas. Sie hilft bei der Zucht und beim Training der Schlittenhunde und verbringt viel Zeit mit der Jagd im Wald. Eines Tages wird sie auf einem Streifzug von einem Fremden überfallen. Tracy wehrt sich und zückt ihr Messer, danach kann sie sich an nichts mehr erinnern. Zu Hause wagt sie nicht, von dem Vorfall zu berichten. Als ein mysteriöser jugendlicher Ausreisser bei der Familie auftaucht und behauptet, von einem Mann verfolgt zu werden, entsteht in Tracy der Verdacht, dass es sich dabei um den verletzten Unbekannten handelt. Immer mehr zu Jesse hingezogen, wird sie von panischer Angst vor dem Fremden im Wald erfasst. Ihr entgleitet alles, und sie zieht erneut ihr Messer …
In einem aussergewöhnlichen Genremix entwickelt Jamey Bradbury eine dramatische Geschichte um ihre jugendliche Hauptfigur, deren animalisches Wesen zugleich fasziniert und verstört. John Irving charakterisiert den Roman als »ungewöhnliche Liebesgeschichte und gruseligen Horrorthriller, der sowohl an die Brontë-Schwestern wie an Stephen King gemahnt«.
Pressestimmen
Eine faszinierende Variante des zurzeit hoch im Kurs stehenden »Nature Writing«, ein Roman, der seine »paranormalen« Elemente dazu benutzt, um tradierte Abgrenzungen zu schleifen beziehungsweise zu ignorieren: die Grenzen zwischen Mensch und Natur, zwischen Intellekt und Instinkt, die Grenzen zwischen Geschlechterrollen und Geschlechteridentitäten.— Thomas Wörtche, Deutschlandfunk Kultur
»Wild« erinnert an Jack Londons Abenteuerromane, doch der Titel ist hier wörtlich zu nehmen. Denn neben dem Erwachsenwerden, der Trauerbewältigung und Identitätssuche hat das Buch noch eine weitaus dunklere Note.— Die Presse
Ein gewaltiges Debüt: komplex, spannend und mystisch.— Oberösterreichische Nachrichten
Die Grenzen zwischen Mensch, Tier und Vampir lässt Bradbury verschwimmen; ihre Protagonistin ist ein radikaler Gegenentwurf zu jeder Form zivilisatorischer Regeln. … Vor dem Setting einer übermächtigen Natur und eines Landes im Vor-Digitalzeitalter entsteht ein Wechselspiel zwischen »inside« und »outside«, ein schwebender Erzählstrom, von Metamorphosen getrieben.— Hannes Hintermeier, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Eine einzigartige Interpretation des Country noir.— Publishers Weekly
Ein grosser Roman über Identität und ihre Grenzen.— Canal+
Ein eindringlicher, phantastischer Roman, der von einem Mädchen getragen wird, das nach Blut und nach Liebe dürstet.— L’Obs
Eine Hymne auf die Natur, aber auch ein phantastischer Roman und ein Thriller, der seinem Titel alle Ehre macht.— Libération