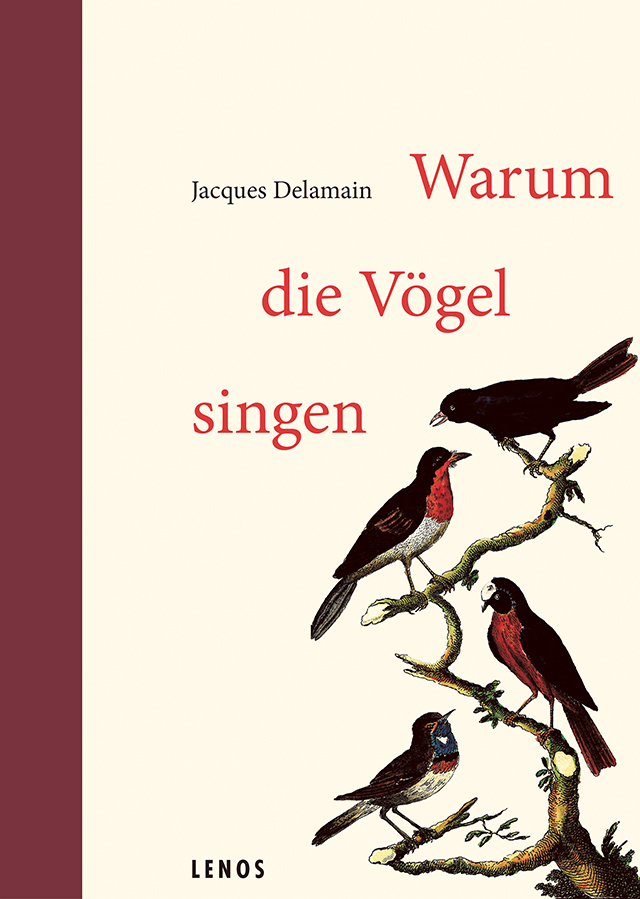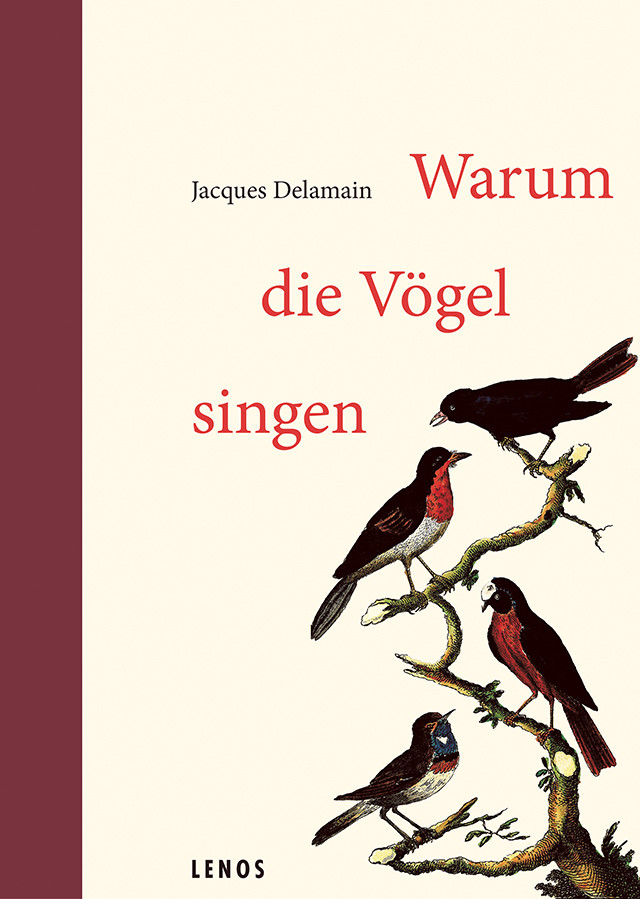Jacques Delamain
Warum die Vögel singen
Aus dem Französischen von Karl Wolfskehl
Herausgegeben und bearbeitet von Raffael Winkler
Mit 30 Illustrationen nach den handkolorierten Kupferstichen von Balthasar Friedrich Leizel
Halbleinen, mit Lesebändchen
ISBN 978-3-03925-021-9
Seiten 219
Erschienen 15. März 2022
€ 29.50 / Fr. 35.00
Warum singen die Vögel? Diese und viele weitere Fragen stellt Jacques Delamain in seinem Buch. Wir erfahren, wie sich eine Schar Meisen gegen ihre Feinde behauptet, oder erleben eine Familie von Wiesenweihen, die gemeinsam Flugübungen macht. Wir folgen dem Lauf des Flusses, der Frühjahrs- und Herbstwanderung der Vögel und erleben das harte Schicksal derjenigen, die im Winter in unseren Breitengraden verharren – bis der Frühling ihre Verwandten wieder zurückbringt.
In poetischer, manchmal barock anmutender Sprache, jedoch immer mit präzisem Blick präsentiert dieses Buch die Welt der Vögel. Dass Literatur und Wissenschaft keine Widersprüche sein müssen, das zeigt uns Jacques Delamain. Ein Text, der mehr als zu unterhalten vermag.
Delamains Wissensschatz erscheint erstmals seit 1930 wieder auf Deutsch; in bibliophilem Gewand mit Reproduktionen handkolorierter Kupferstiche von Balthasar Friedrich Leizel.
»Bei Delamain treffen wir auf einen Poeten, der mit der Beobachtungsgabe eines Naturwissenschaftlers ausgerüstet ist, der aber die Ergebnisse nicht in Tabellenform, sondern in einer bildhaften, stimmungsgeladenen und gefühlsbetonten Sprache wiedergibt.«
Raffael Winkler, Herausgeber
Pressestimmen
Wer noch kein Vogelfan ist, kann es mit diesem bezaubernden Buch werden.— Alfred Schlienger, bz Basel