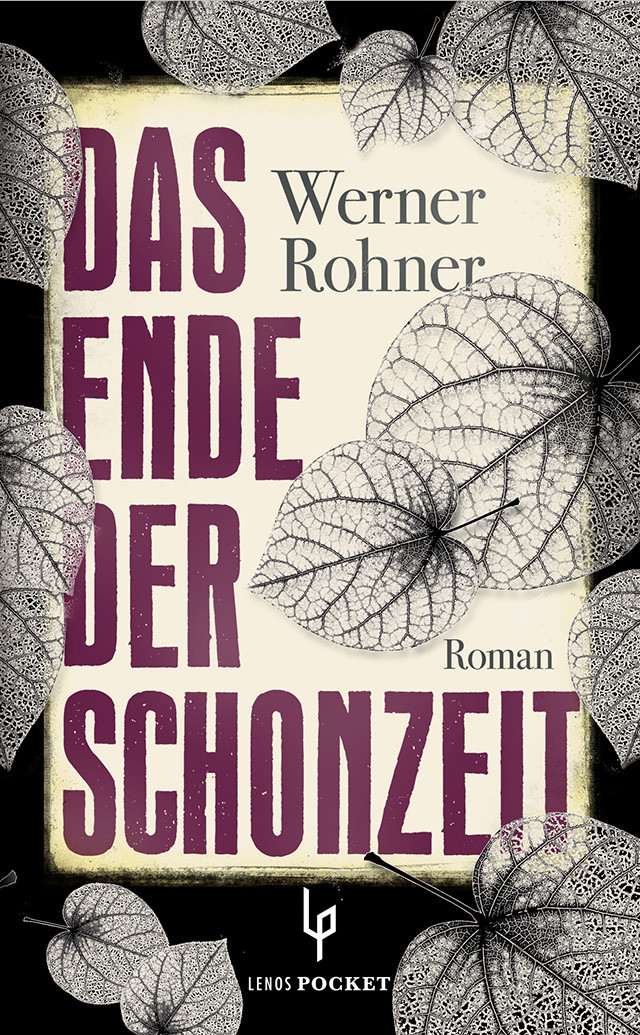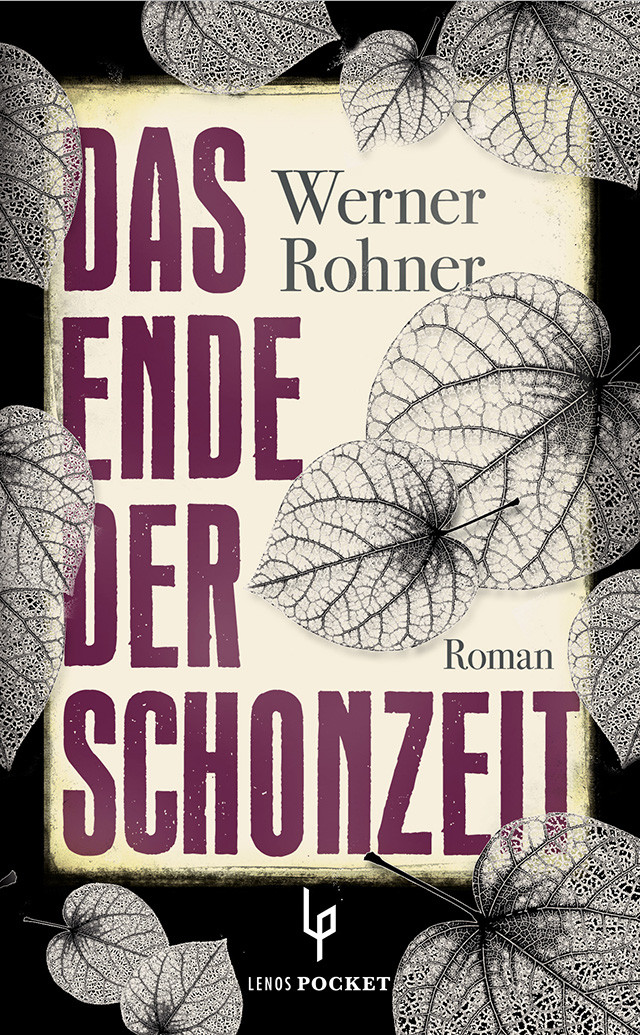Werner Rohner
Das Ende der Schonzeit
ISBN 978-3-85787-780-3
Seiten 187
Erschienen 15. Januar 2016
€ 12.90 / Fr. 17.50
In seinem klug komponierten Debütroman erzählt Werner Rohner die Geschichte eines jungen Mannes, der in seine Heimatstadt zurückkehrt. Dort holen Joris die Erinnerungen ein: an den Krebstod seiner Mutter zehn Jahre zuvor, an das Versprechen, ihr beim Sterben zu helfen, aber auch an seine Beziehung in Wien, in die er sich stattdessen geflüchtet hatte.
In Zürich beginnt für ihn ein neues Kapitel. Am Abend seines ersten Arbeitstages beim Fernsehen stösst er in der Zeitung auf das Foto eines Mannes, den er nicht kennt, jedoch sofort erkennt, so ähnlich sieht er ihm: sein Vater. Als sich die beiden Männer schliesslich treffen, erfährt Joris, dass nicht nur er, sondern auch seine Mutter im politischen Untergrund aktiv gewesen war. Diese Begegnung zwingt ihn, sein eigenes Leben und das der Mutter neu zu begreifen.
Mit einer lebendigen Sprache dringt der Roman in Bereiche vor, in denen das Politische und das Private nicht mehr voneinander zu trennen sind.
Pressestimmen
Das schönste Debüt dieses Jahres.— Mona Vetsch, Schweizer Fernsehen
Das Debüt des Zürchers Werner Rohner hat eine hohe und konstante Flughöhe. Mehr als einmal denkt man bei der Lektüre an Musils Mann ohne Eigenschaften. … Rohners Ton legt sich einem beim Lesen wie eine kühle Hand auf die Schulter. Man fröstelt – und liest begierig weiter.— Regula Freuler, NZZ am Sonntag
Werner Rohner greift die alten Fragen nach der Herkunft, nach den Wurzeln auf, er thematisiert die Sehnsucht nach geregelten (Familien-)Verhältnissen ebenso wie das Leiden, wenn diese nicht erfüllt wird. Das mag bei einem noch relativ jungen Autor erstaunen – andererseits zeigt es, dass auch weiterhin die alten Themen, nämlich Liebe, (Verlust-)Angst, Schmerz und Tod, die Literatur ausmachen. Der eigene Ton und die Erzählanlage, die Werner Rohner für seinen Roman gewählt hat, überzeugen.— Liliane Studer, Viceversa
Wie das alles zusammenpasst! Die genauen Beobachtungen, die exakt geschilderten Gesten, Mienenspiele, die niemals klischeehaften Metaphern … Die Geschichte fesselt ungeheuer, führt vom Sterben der Mutter zu Treffen mit dem Vater, von der Politik der Siebziger zur Fichenaffäre der späten Achtziger, vom Beginn einer Liebesbeziehung bis zu ihrem schmerzhaften Übergang in eine Freundschaft, von Schuldgefühlen bis zum zaghaften Gefühl, mit sich im Reinen zu sein.— Bernd Schuchter, Vorarlberger Nachrichten
Das Ende der Schonzeit ist ein stilles, eindringliches Buch, das vom Tod und vom Abschiednehmen handelt und von der Suche nach den eigenen Wurzeln.— Der Landbote
Wenn Sie in Das Ende der Schonzeit den ersten Satz gelesen haben, sind Sie ohnehin schon verloren. Verloren im kleinen Universum eines grossartigen Buches, das Sie bereichern wird, das einen emotional durchwäscht, das eine grosse Nähe zu allen Figuren schafft und dabei doch nie jemandem zu nahe tritt.— Sonja Wenger, ensuite
Rohner erzählt auf eine exakte und gleichzeitig leidenschaftliche Weise, die mich sehr angesprochen hat.— Heimo Strempfl, Österreichischer Rundfunk
Der Roman besticht durch Präzision und Stilwillen.— Tagesschau, Schweizer Fernsehen
So hat man das noch nicht gelesen: eine zärtliche, bedrückende und befreiende Geschichte vom Sterben der Mutter, erzählt von ihrem jungen Sohn.— Kreuzlinger Zeitung
In nur wenigen Sätzen zeigt Rohner, wie eine Leidenschaft aufflammt, eine Beziehung alltäglich wird und eine Liebe einschläft. Hier beweist der Autor sowohl seine grosse Menschenkenntnis als auch sein Talent dafür, Beobachtungen in wohlgewählte Worte zu fassen.— literaturkritik.de